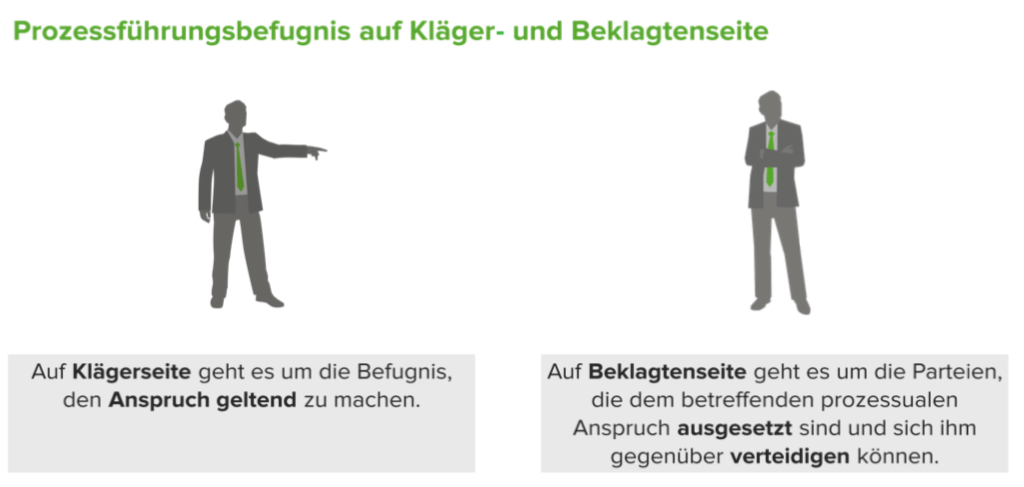I. Wer ist überhaupt „Partei“?
Die parteibezogenen Vorschriften der ZPO finden sich in den §§ 50 ff. ZPO. In diesem Abschnitt sind sowohl die Partei- als auch die Prozessfähigkeit geregelt. Doch vorab sollte man sich klarmachen, wer mit „Partei“ gemeint ist.
Partei im Zivilprozess ist derjenige, der im eigenen Namen Rechtsschutz begehrt (Kläger) oder gegen den Rechtsschutz begehrt wird (Beklagter).
Wer die Parteien sind, wird durch die entsprechenden Bezeichnungen in der Klageschrift ermittelt, §§ 253 Abs. 2, 130 Nr. 1 ZPO (man spricht vom formellen Parteibegriff). Im Zivilprozess gilt das Zweiparteienprinzip, grundsätzlich sind nur zwei Parteien in einem Verfahren vorgesehen: Kläger und Beklagter.
II. Die Parteifähigkeit, § 50 ZPO
Die Parteifähigkeit ist in § 50 ZPO geregelt.
Unter Parteifähigkeit ist die Fähigkeit zu verstehen, selbst Subjekt eines zivilrechtlichen Verfahrens zu sein.
Nach § 50 Abs. 1 ZPO ist parteifähig, wer rechtsfähig ist, also selbst Träger von Rechten und Pflichten sein kann. Damit sind schon mal natürliche und juristische Personen parteifähig, daneben auch OHG und KG (vgl. § 124 Abs. 1 HGB). Auch die Rechtsfähigkeit der GbR ist inzwischen höchstrichterlich anerkannt, sodass eine GbR ebenfalls parteifähig ist.
Es wird zudem zwischen aktiver und passiver Parteifähigkeit unterschieden (Legitimation). Aktiv parteifähig ist, wer selbst Kläger in einem zivilgerichtlichen Verfahren sein kann. Passiv parteifähig ist, wer Beklagter sein kann.
§ 50 Abs. 2 ZPO gibt die Möglichkeit, auch einen nicht-rechtsfähigen Verein zu verklagen. Zudem kann der nicht-rechtsfähige Verein auch selber klagen: Er ist damit durch § 50 II ZPO aktiv und passiv parteifähig. Diese Vorschrift wurde vor allem aus Gläubigerschutzgründen eingeführt, da es für diese bedeutend einfacher ist, sich direkt an den Verein zu wenden, anstatt an einzelne (oftmals wechselnde) Mitglieder.
II. Die Prozessfähigkeit, § 51 ZPO
Die Prozessfähigkeit, geregelt in § 51 ZPO, ist die Fähigkeit, Prozesshandlungen wirksam vorzunehmen und entgegen zu nehmen.
Gem. § 52 ZPO ist eine Person prozessfähig, soweit sie sich durch Verträge verpflichten kann.
Im Gegensatz zur Parteifähigkeit knüpft die Prozessfähigkeit demnach nicht an die Rechtsfähigkeit, sondern an die Geschäftsfähigkeit (§§ 104 ff. BGB).
Ob die Prozessfähigkeit fehlt, muss bei Zweifeln durch einen Sachverständigen geklärt werden.
III. Die Postulationsfähigkeit
In engem Zusammenhang mit der Prozessfähigkeit ist die Postulationsfähigkeit zu verstehen.
Die Postulationsfähigkeit ist die Fähigkeit, vor Gericht auftreten und wirksam Prozesshandlungen vornehmen zu können.
Grundsätzlich ist jede prozessfähige Partei auch postulationsfähig.
Eine Ausnahme dazu normiert § 78 Abs. 1 ZPO: Danach müssen sich die Parteien bei sämtlichen Prozessen vor den Landes- und Oberlandesgerichten anwaltlich vertreten lassen (Anwaltszwang). In solchen Verfahren können die Parteien selbst nicht wirksam Prozesshandlungen vornehmen, sondern müssen dies über ihre Anwälte machen. Erscheinen die Parteien ohne Anwalt werden Sie nicht gehört, was dazu führen kann, dass bspw. ein Versäumnisurteil ergeht.
IV. Die Prozessführungsbefugnis
Schließlich ist auch noch die Prozessführungsbefugnis zu beachten.
Darunter versteht man die Befugnis, im eigenen Namen über das streitige Recht zu prozessieren.
Sie besteht für den Kläger grundsätzlich dann, wenn er behauptet, das streitige Recht stehe ihm selbst zu.
Daneben gibt es auch Fälle, in denen ein fremdes Recht im eigenen Namen geltend gemacht werden soll (man spricht dann von der sog. Prozessstandschaft).
Man unterscheidet zwischen gesetzlicher und gewillkürter Prozessstandschaft:
Während die gesetzliche Prozessstandschaft eine Vertretung kraft Gesetzes vorsieht, ist die gewillkürte Prozesstandschaft in der ZPO nicht geregelt. Dennoch ist die Möglichkeit einer gewillkürten Prozessstandschaft allgemein anerkannt. Die Voraussetzungen dafür sind gleichwohl eng gefasst:
- Der Kläger muss vom Rechtsinhaber ermächtigt worden sein, das Recht gerichtlich geltend zu machen
- Der Kläger muss ein eigenes, schutzwürdiges Interesse daran haben, das fremde Recht gerichtlich geltend zu machen; dies ist dann gegeben, wenn die Entscheidung Einfluss auf die eigene Rechtslage des Prozessführungsbefugten hat. Beispiele hierfür sind Fälle der Drittschadensliquidation.
- Die Geltendmachung des Anspruchs darf schließlich nicht rechtsmissbräuchlich sein; dies wäre jedenfalls dann zu bejahen, wenn der Beklagte dadurch unbillig benachteiligt würde; dies wäre beispielsweise dann der Fall, wenn der Prozessführungsbefugte zahlungsunfähig wäre und damit bei erfolgloser Klage die Durchsetzbarkeit des dem Beklagten zustehenden Kostenerstattungsanspruchs gefährdet wäre;
Sind diese Voraussetzungen gegeben, so ist die gewillkürte Prozessstandschaft im konkreten Fall zulässig.