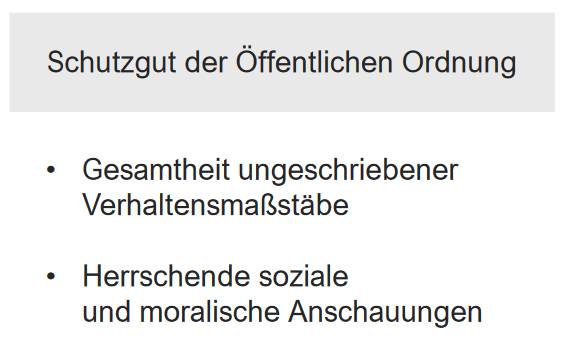Schema
1. Ermächtigungsgrundlage [z.B. § 8 PolG NRW, § 3 SOG, § 1, 3 PolG BW, § 11 NdsSOG, § 9 PolG RLP, § 14 BPolG]
2. formelle Rechtmäßigkeit
a. Zuständigkeit
b. Verfahren
c. Form
3. materielle Rechtmäßigkeit [Voraussetzungen der jeweiligen landesrechtlichen Vorschrift]
im Allgemeinen sind folgende Punkte zu prüfen:
a. Schutzgut
aa. öffentliche Sicherheit
bb. öffentliche Ordnung
b. Gefahr
c. richtiger Störer/Ordnungspflichtigkeit
4. Rechtsfolge: Ermessen
a. Entschließungsermessen
b. Auswahlermessen
aa. Störerauswahl
bb. Mittelauswahl
1. Ermächtigungsgrundlage
Damit die Polizei- und Ordnungsbehörden Maßnahmen ergreifen dürfen, die einen Eingriff in die Rechte der Bürger darstellen, müssen sie aufgrund einer Ermächtigungsgrundlage handeln.
Bei der Suche nach einer solchen muss zuerst auf Spezialgesetze (wie beispielsweise das Versammlungsgesetz) zurückgegriffen werden. Befindet sich hier keine geeignete Ermächtigungsgrundlage, ist das Polizei- und Ordnungsrecht heranzuziehen. Dabei gilt grundsätzlich, dass den Standardmaßnahmen Vorrang vor den Generalklauseln zukommt. Erst wenn keine Standardmaßnahme einschlägig ist, ist ein Rückgriff auf die Generealklausel zulässig. Sie sind sowohl für Verwaltungs- als auch für Realakte taugliche Ermächtigungsgrundlagen.
In den meisten Bundesländern regelt eine Generalklausel die Befugnisse der Polizei und der Ordnungsbehörden. Beispiele für Generalklauseln sind § 13 SOG LSA, § 8 PolG NRW, § 14 BPolG, § 10 BbgPolG.
Die Generalklauseln haben in allen Bundesländern einen ähnlichen Wortlaut. Sie ermöglichen dabei ein Tätigwerden der Polizei bzw. der Ordnungsbehörde, wenn eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung vorliegt bzw. bereits eine Störung eingetreten ist. Um zu bestimmen, gegen wen sich die behördliche Maßnahme richtet, müssen zusätzlich die jeweiligen Vorschriften zur polizeirechtlichen Verantwortlichkeit sowie zur ausnahmsweisen Inanspruchnahme von Nichtverantwortlichen herangezogen werden.
2. formelle Rechtmäßigkeit
An dieser Stelle sind – wie immer im Verwaltungsrecht – Zuständigkeit, Verfahren und Form zu prüfen. Meist genügt an dieser Stelle die jeweiligen Normen aus dem Landesrecht kurz zu nennen.
In Bundesländern, in denen das sog. Trennungsprinzip gilt, sind generell die allgemeinen Ordnungsbehörden zuständig. An dieser Stelle muss häufig die spezielle Zuständigkeit der Polizei problematisiert werden. Meist ist die Polizei dann zuständig, wenn es sich um eine unaufschiebbare Maßnahme handelt, wenn also eine effektive Gefahrenabwehr durch die allgemeinen Ordnungsbehörden nicht mehr möglich ist.
Hinsichtlich des Verfahrens sollte immer an die Anhörung nach § 28 VwVfG gedacht werden. Diese kann bspw. bei Gefahr im Verzug entbehrlich sein.
I.d.R. unterliegen polizei- und ordnungsrechtliche Maßnahmen keinen besonderen Formvorschriften.
3. materielle Rechtmäßigkeit
Die materiellen Voraussetzungen richten sich nach der jeweiligen landesrechtlichen Generalklausel. Da diese allerdings sehr ähnlich sind, wird im Folgenden auf die typischen Tatbestandsmerkmale eingegangen. In der Klausur und Hausarbeit ist es jedoch wichtig, den genauen Wortlaut aus der eigenen landesrechtlichen Vorschrift zu Grunde zu legen!
a. Schutzgut
Als Schutzgüter im Rahmen der Generalklausel nennen die Polizei- und Ordnungsgesetze die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Die jeweiligen Definitionen gehören zum absoluten Grundwissen im Gefahrenabwehrrecht. Manche Bundesländer haben die Begriffe legaldefiniert, dann sollte natürlich auf die entsprechenden Normen verwiesen werden (Bspw. § 3 Nr. 1 und 2 SOG LSA).
aa. öffentlichen Sicherheit
Definition: Die öffentliche Sicherheit wird definiert als die Unverletzlichkeit der Rechtsordnung, der subjektiven Rechte und Rechtsgüter des Einzelnen sowie des Bestandes, der Einrichtungen und Veranstaltungen des Staates oder sonstiger Träger von Hoheitsgewalt.
Die Nennung der Unverletzlichkeit der Rechtsordnung hat zur Folge, dass stets eine Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit vorliegt, wenn gegen eine Rechtsnorm verstoßen wird. Hiervon sind auch Rechtsverordnungen und Satzungen erfasst.
Hinsichtlich der subjektiven Rechte ist zu beachten, dass ein Schutz privater Rechte nur insofern möglich ist, als dass die gerichtliche Durchsetzung von Ansprüchen gesichert oder ermöglicht wird.
Daneben führt auch eine ausschließliche Selbstgefährdung nach herrschender Meinung grundsätzlich nicht zu einer Betroffenheit der öffentlichen Sicherheit, sofern sie von einem freien Willen getragen ist.
bb. öffentlichen Ordnung
Definition: Die öffentliche Ordnung wird als die Gesamtheit der im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung liegenden ungeschriebenen Regeln für das Verhalten des einzelnen in der Öffentlichkeit, deren Beachtung nach den jeweils herrschenden Anschauungen als unerlässliche Voraussetzung eines geordneten staatsbürgerlichen Zusammenlebens gilt definiert.
Die Betroffenheit der öffentlichen Ordnung ist gegenüber der öffentlichen Sicherheit streng subsidiär zu prüfen. Sie muss in der Klausur nicht mehr angesprochen werden, wenn bereits eine Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit vorliegt.
b. konkrete Gefahr
Die polizei- und ordnungsrechtlichen Generalklauseln erfordern darüber hinaus das Vorhandensein einer konkreten Gefahr.
Definition: Eine konkrete Gefahr liegt vor, wenn im Einzelfall bei einem ungehinderten Ablauf des Geschehens aus der ex ante-Perspektive die hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass ein polizeilich geschütztes Rechtsgut zu Schaden kommt.
Im Fall einer Störung hat sich diese bereits realisiert.
Stellt sich im Nachhinein doch heraus, dass tatsächlich keine Gefahr vorlag, handelt es sich um eine sogenannte Anscheinsgefahr. Auch bei Vorliegen einer solchen durfte der Eingriff erfolgen.
Demgegenüber spricht man von einer Scheingefahr oder Putativgefahr, wenn ein gewissenhafter sachkundiger Beamter in der konkreten Situation keine Gefahr angenommen hätte, der tatsächlich Handelnde jedoch hiervon ausgegangen ist. In diesem Fall ist das Handeln nicht von der Generalklausel gedeckt.
Schließlich ist die Situation denkbar, dass objektiv Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Gefahr bestehen, ein Schadenseintritt jedoch aus der Sicht der Polizei- bzw. Ordnungsbehörde noch nicht hinreichend wahrscheinlich ist. Hierbei handelt es sich um einen Gefahrenverdacht. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach der Befugnis zu sogenannten Gefahrerforschungsmaßnahmen. Nach überwiegender Auffassung bedürfen solche keiner gesonderten Ermächtigungsgrundlage. Sie sind demnach ebenfalls von der Generalklausel gedeckt.
c. richtiger Störer
Hinzukommend stellt sich die Frage nach dem richtigen Adressaten des polizei- bzw. ordnungsbehördlichen Handelns. Grundsätzlich ist dies der für eine Gefahr Verantwortliche. Je nach Bundesland wird diese Person auch als Störer oder Ordnungspflichtiger bezeichnet.
An dieser Stelle muss in den Zustands- und Verhaltensstörer unterschieden werden.
Definition: Ein Verhaltensstörer ist derjenige, dessen Handeln oder Unterlassen die Quelle der Gefahr ist.
Definition: Demgegenüber ist derjenige Zustandsstörer, der die Verantwortung für die Sache hat, deren Zustand die Gefahr verursacht.
Fraglich ist dabei, welche Anforderungen an den Verursachungszusammenhang gestellt werden. Nach herrschender Auffassung wird dabei auf die unmittelbare Verursachung abgestellt. Danach ist derjenige Störer, der die Gefahrenschwelle überschreitet.
Kann kein Störer zur Verantwortung gezogen werden bzw. würde dies nicht zum Erfolg führen, kann die Polizei- bzw. die Ordnungsbehörde selbst handeln. Kommt diese Möglichkeit ebenfalls nicht in Betracht, ist die Inanspruchnahme eines Nichtverantwortlichen möglich. Dieser hat mit der Gefahr selbst nichts zu tun, kann aber Abhilfe schaffen.
Korrespondierend mit den Ausführungen zur Anscheinsgefahr und dem Gefahrenverdacht können auch der Anscheins- und der Verdachtsstörer in Anspruch genommen werden, wobei hinsichtlich des Verdachtsstörers umstritten ist, ob er die mögliche Gefahr selbst untersuchen muss oder lediglich den Gefahrerforschungseingriff durch die Behörde zu dulden hat.
Bei der Prüfung des Verantwortlichen sind gegebenenfalls auch die Sonderfälle des Zweckveranlassers bzw. des latenten Störers zu thematisieren. Der Zweckveranlasser muss sich die Gefahr selbst zurechnen lassen, wenn zwischen seiner Veranlassung und dem Verhalten Dritter, das die Gefahr herbeiführt, ein ausreichend enger Zusammenhang besteht. Der latente Störer ist dagegen für eine Sache verantwortlich, die aufgrund des Hinzutretens weiterer Umstände für eine Gefahr ursächlich ist.
Problematisch kann auch die Frage der Verantwortlichkeit bei Rechtsnachfolge sein.
4. Rechtsfolge: Ermessen
Sind die tatbestandlichen Voraussetzungen der Generalklausel erfüllt, stehen der Polizei bzw. der Ordnungsbehörde grundsätzlich ein Entschließungs- und ein Auswahlermessen zu. Das Entschließungsermessen betrifft die Frage, ob sie tätig wird. Hat sie sich zu einem Tätigwerden entschlossen, muss sie im Rahmen des Auswahlermessens entscheiden, wie sie tätig wird. An dieser Stelle sind insbesondere mögliche Ermessensfehler zu thematisieren.
Der Prüfungspunkt „Störerauswahl“ ist nur dann relevant, wenn es mehrere Störer gibt.
Im Rahmen der Mittelauswahl geht es um die Verhältnismäßigkeit nach Art. 20 Abs. 3 GG der Maßnahme. I.d.R. existiert im jeweiligen Landesrecht eine Vorschrift, die dies noch einmal konkretisiert (bspw. § 5 SOG LSA).